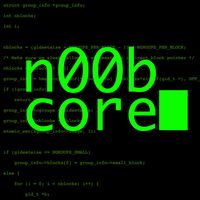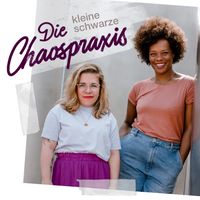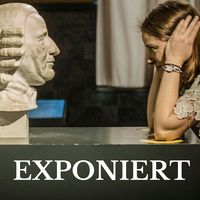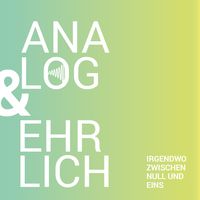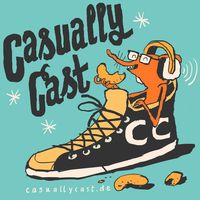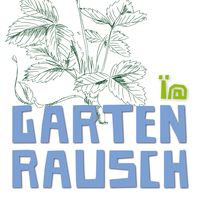Wie gelingt das „normale“ Leben nach einem Psychiatrieaufenthalt? radioeins-Moderatorin Sonja Koppitz weiß, wovon sie spricht, nicht nur durch ihre eigene Depression. Zwei Jahre nach ihrem erfolgreichen Podcast „Spinnst Du?“, für den sie sich damals eine Woche in die Psychiatrie begeben hat, macht sie sich erneut auf die Reise in die Welt psychischer Erkrankungen und Therapien. Diesmal geht sie der Frage nach: Wie gelingt der Weg zurück in den Alltag und damit zurück ins Leben?
https://www.radioeins.de/archiv/podcast/spinnstdu.html
Gesamtlänge aller Episoden: 11 hours
recommended podcasts
Empfehlung: Die Alltagsfeministinnen – der Podcast für mehr Gleichberechtigung
Ihr wollt gleichberechtigt leben – in Partnerschaft, Job und Familie - aber irgendwie kommt immer was dazwischen? Die Alltagsfeministinnen zeigen euch, wie ihr eure Ideale lebt. Sonja Koppitz ist Journalistin, Johanna Fröhlich Zapata ist Coach für Alltagsfeminismus. Jede Woche sprechen die beiden über alltägliche Situationen, die wie Kleinkram wirken, aber in Wirklichkeit viel Zündstoff bieten...
Klinik - und dann? (S2/E01)
Nach der Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik ist man nicht automatisch gesund, denn Depressionen können immer wieder kommen. Auch wenn sich der eigene Zustand gebessert hat, ist der Einstieg in den Alltag, das Berufs- und Familienleben schwierig. Auch Sonja Koppitz kennt diese Situation und zeigt in dieser Folge Möglichkeiten der Unterstützung: Tageskliniken, Wohngemeinschaften und andere Formen der Hilfe bei der vorsichtigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Klinik - und dann? (S2/E01)
Nach der Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik ist man nicht automatisch gesund, denn Depressionen können immer wieder kommen. Auch wenn sich der eigene Zustand gebessert hat, ist der Einstieg in den Alltag, das Berufs- und Familienleben schwierig. Auch Sonja Koppitz kennt diese Situation und zeigt in dieser Folge Möglichkeiten der Unterstützung: Tageskliniken, Wohngemeinschaften und andere Formen der Hilfe bei der vorsichtigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Der Kampf um Therapieplätze (S2/E02)
Während der Recherche zu dieser Staffel "Spinnst du?" ereilt auch Sonja Koppitz erneut eine Depression. Gemeinsam mit den Erfahrungen einer Kollegin und einer Freundin beschreibt sie in dieser Folge die schwierige Suche nach einem Therapieplatz und hakt bei der Politik nach, warum es in Deutschland immer noch viel zu wenig zugelassene Therapeut*innen gibt.
Der Kampf um Therapieplätze (S2/E02)
Während der Recherche zu dieser Staffel "Spinnst du?" ereilt auch Sonja Koppitz erneut eine Depression. Gemeinsam mit den Erfahrungen einer Kollegin und einer Freundin beschreibt sie in dieser Folge die schwierige Suche nach einem Therapieplatz und hakt bei der Politik nach, warum es in Deutschland immer noch viel zu wenig zugelassene Therapeut*innen gibt.
Zurück in den Job (S2/E03)
Wenn der Berufsalltag immer wieder durch Phasen mit Depressionen durchbrochen wird, ist der Wiedereinstieg schwer. Sonja Koppitz probiert es mit tiergestützter Therapie und begleitet eine Kollegin bei ihrer ersten Sendung nach einem Klinikaufenthalt.
Zurück in den Job (S2/E03)
Wenn der Berufsalltag immer wieder durch Phasen mit Depressionen durchbrochen wird, ist der Wiedereinstieg schwer. Sonja Koppitz probiert es mit tiergestützter Therapie und begleitet eine Kollegin bei ihrer ersten Sendung nach einem Klinikaufenthalt.
Der Kummer der Kümmerer (S2/E04)
Wenn die beste Freundin, der Partner oder die Partnerin, Angehörige oder Kolleg*innen an einer Depression erkranken, lässt einen das nicht unberührt. Sonja Koppitz kennt beide Seiten, die der Erkrankten und die der Kümmerin, und sie macht deutlich: Nur, wer für sich selbst sorgt, kann für andere sorgen.